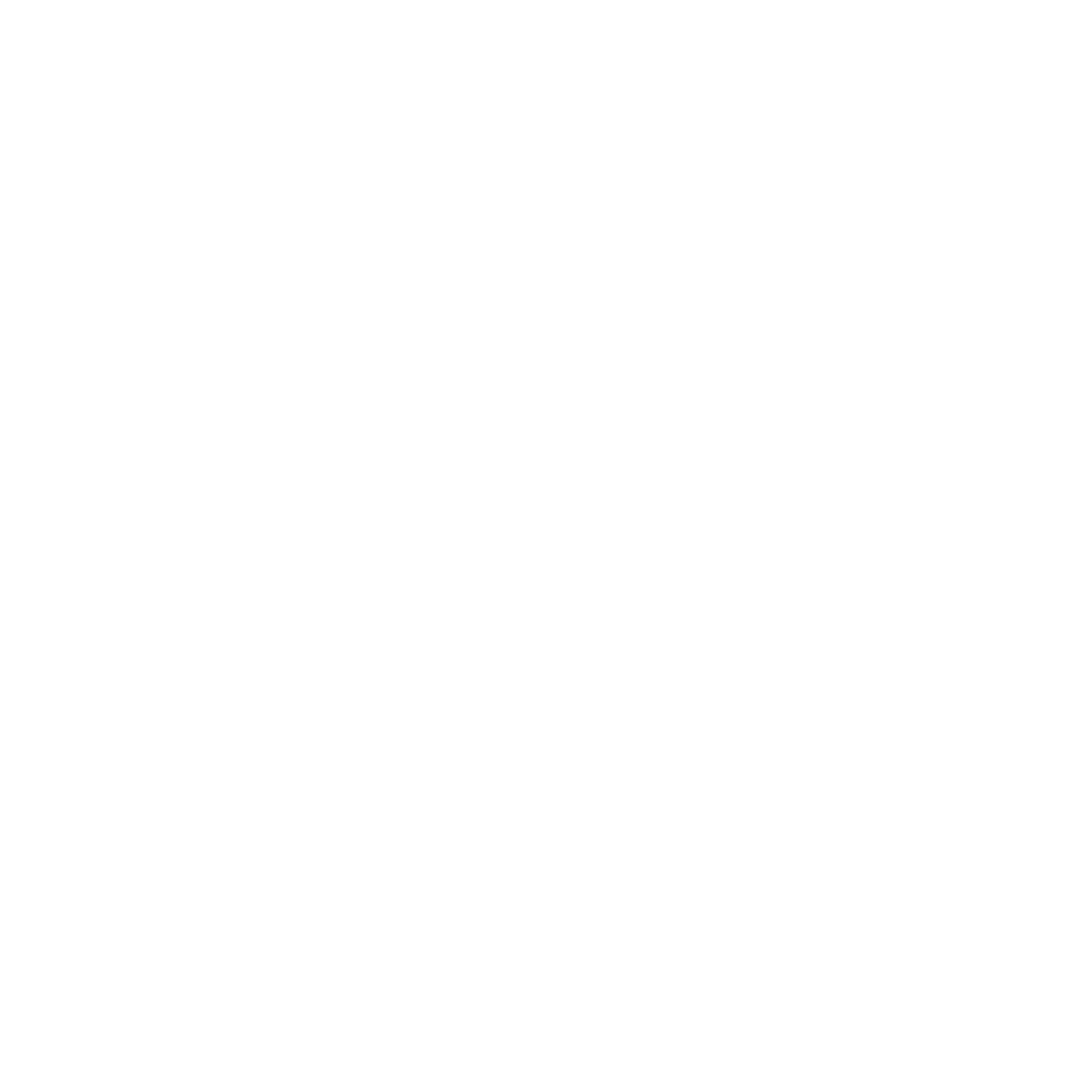Sport
zur Gesundheitsprävention
-
Nach den Nationalen Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung und der Leitlinien für Kraftsport der American Heart Association
zur Gesundheitsprävention
-
Nach den Nationalen Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung und der Leitlinien für Kraftsport der American Heart Association
Sport
zur Gesundheitsprävention
zur Gesundheitsprävention
< Zurück zur Gesundheitsakademie
Veröffentlicht am 20.10.2025
Zuletzt überarbeitet am 20.10.2025
Lesedauer ca. 15 min
Ziel des Artikel - Aufklären und Motivieren
Das Wichtigste über gesundheitspräventiven Sport in Kürze:
Sport im Sinne der Gesundheitsprävention ist bewusst ausgeführte körperliche Aktivität, die darauf abzielt, Herz, Kreislauf und Muskulatur zu stärken. Sport sollte spürbar sein, durch ein Gefühl körperlicher Anstrengung und Erschöpfung. Mitentscheidend für den präventiven Faktor von Sport ist, dass die körperliche Anstrengung auf Sport ausgelegt ist und nicht im Rahmen z.B. beruflicher Tätigkeit anfällt. Im Fokus stehen dabei Ausdauertraining (z. B. Joggen, Radfahren) und Krafttraining (z. B. Klimmzüge, Kniebeugen).
Wie viel Sport sollte man pro Woche machen? Zum Abschnitt
Für die Gesundheitsprävention werden mindestens 150 Minuten moderate oder 75 Minuten intensive Ausdaueraktivität pro Woche plus mindestens zwei Einheiten Krafttraining empfohlen.
Welche Gesundheitsvorteile hat man durch Sport? Zum Abschnitt
Regelmäßiger Sport zählt zu den wirkungsvollsten Maßnahmen, um gesund zu bleiben: Er senkt Blutdruck und Blutzucker, beugt Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor und verbessert die körperliche Leistungsfähigkeit. Ausdauertraining stärkt das Herzkreislaufsystem, die Lunge und den Stoffwechsel; Krafttraining schützt Muskeln und Knochen. Zusätzlich wirkt Sport positiv auf Psyche, Schlaf und Stressverarbeitung und kann im Krankheitsfall die Heilungschancen verbessern.
Wie viel (gesunde) Lebenszeit erhält man im Gegensatz zu Menschen, die keinen Sport treiben? Zum Abschnitt
Sport kann die gesunde Lebenszeit um bis 5 Jahre erhöhen.
Wie misst man die Intensität der sportlichen Aktivität? Zum Abschnitt
Die Intensität körperlicher Aktivität kann in leicht, moderat und intensiv eingeteilt werden. Für die Gesundheitsförderung gelten vor allem moderate und intensive Belastungen als besonders wirksam. Die Einschätzung erfolgt z. B. über die Herzfrequenz bzw. Bereiche anhand der maximalen Herzfrequenz (HFmax), mit der Borg-Skala (subjektives Belastungsempfinden) oder dem Sprechtest.
- Oliver, Chief of Health (CoH) bei whale.health -
Definition von Sport für Gesundheisprävention
Definition von Sport für Gesundheisprävention
Sportliche Aktivität im präventiven Kontext lässt sich in zwei zentrale Bereiche unterteilen: Ausdauertraining und Krafttraining. Ausdauertraining, wie Radfahren, Schwimmen oder Joggen, stärkt vor allem das Herz-Kreislauf-System. Krafttraining hingegen umfasst Übungen wie Kniebeugen, Liegestütze oder Klimmzüge, es dient vor allem dem Erhalt und Aufbau von Muskulatur. Beide Trainingsformen sind für die Gesundheitsprävention bedeutsam und sollten einen adäquaten Stellenwert in jedem Trainingsplan haben.
Was ist besser, Ausdauersport oder Kraftsport?
- Ausdauertraining wirkt besonders stark auf klassische Risikofaktoren wie Bluthochdruck, hohe Blutfette und Übergewicht. Es verbessert die Herz-Kreislauf-Leistung und senkt nachweislich das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.
- Krafttraining senkt ebenfalls Blutdruck, verbessert den Blutzucker, schützt die Muskulatur (besonders im Alter) und wirkt sich positiv auf die Körperzusammensetzung aus.
Wie viel Sport pro Woche wird empfohlen?
Wie viel Sport pro Woche wird empfohlen?
Die gesundheitlichen Vorteile durch Sport
Die gesundheitlichen Vorteile durch Sport
Ausdauertraining stärkt Herz, Lunge und Stoffwechsel, während Krafttraining die Muskulatur erhält, die Knochendichte stärkt und die Körperzusammensetzung verbessert. Gemeinsam schützen beide Trainingsformen deutlich vor chronischen Erkrankungen, sie verringern Sterblichkeit, verlängern die gesunde Lebenszeit und erhöhen die Lebensqualität, vor allem im Alter, .
Darüber hinaus steigert Bewegung die körperliche Leistungsfähigkeit im Alltag und verbessert zudem das psychische Wohlbefinden. Sport verbessert also nicht nur die körperlich Fitness, sondern auch mentale und psychische Verfassung und Resilienz.
Besonders wichtig zu verstehen ist, dass Sport nicht nur das Leben an sich verlängern kann, sondern vor allem die wertvolle gesunde Lebenszeit. Zudem verbessert Sport nachweislich in den meisten Fällen das Outcome und die Heilungschancen im Falle einer Erkrankung.
"Je besser die körperlicher und geistiger Verfassung ist, in der man erkrankt, desto besser geht man aus dieser Erkrankung hervor - better In, better Out."
Die gesundheitlichen Vorteile durch Sport
Kraft-
training
Ausdauer-
training
gering +
gering +
Sport senken Blutdruck leicht bis moderat um etwa 2–4 mmHg
geringer Einfluss +
geringer Einfluss +
geringer Einfluss +
Der Einfluss von Sport auf Blutfette ist begrenzt, da Cholesterinwerte vor allem genetisch bestimmt sind und meist nur medikamentös deutlich gesenkt werden können.
geringer Einfluss +
mäßiger Einfluss ++
hoher Einfluss +++
Am stärksten wirkt die Kombination auf die Blutzuckerreduktion. Eine relevante Reduktion ist jedoch nur mit Medikamenten möglich.
Sport allein führt meist nur zu moderater Gewichtsabnahme, da vor allem Fett abgebaut und gleichzeitig Muskulatur aufgebaut wird – das Gewicht bleibt oft stabil, die Körperzusammensetzung verbessert sich jedoch deutlich.
Krafttraining ist besonders wichtig für den Erhalt und Aufbau von Muskelmasse, die Kombination aus Kraft und Ausdauertraining hat jedoch einen noch besten Effekt.
Kombinationstraining reduziert Körperfett am effektivsten
sehr vorteilhaft +++
Die fettfreie Körpermasse wird durch Kombinationstraining und Krafttraining stärker positiv beeinflusst als durch Ausdauertraining.
Zusätzliche gesundheitlichen Vorteile durch Sport
Zusätzliche gesundheitlichen Vorteile durch Sport
- Verbesserung der Lungenfunktion: Die Atemmuskulatur wird gestärkt, was die Sauerstoffaufnahme und Belastbarkeit verbessert.
- Positive Effekte auf das Gehirn: Sport verbessert Konzentration, Aufmerksamkeit und Gedächtnis und verringert das Risiko für Demenz
- Stimmungsaufhellung und Stressreduktion: Sport reduziert z.B. das Risiko für Depressionen
- Verbesserung der Schlafqualität
- Beugt Osteoporose (Abbau der Knochendichte) vor
- Sturzprophylaxe, vor allem im Alter: Sport fördert Gleichgewicht, Koordination und Reaktionsfähigkeit sowie die Verbesserung der Haltung und Stabilität der Gelenke
- Lindert Rücken- und Muskelschmerzen
- Trägt erheblich zum erhält die Selbstständigkeit im Alltag bei
- Unterstützt Wachstum, Koordination und Körpergefühl bei Kindern und Jugendlichen
Der Einfluss von Sport auf Lebenserwartung und gesunde Lebenszeit
Der Einfluss von Sport auf Lebenserwartung und gesunde Lebenszeit
Besonders groß ist der gesundheitliche Zugewinn bei Menschen, die bisher gar keinen Sport treiben: Schon moderate sportliche Aktivität kann 2 bis 4 zusätzliche gesunde Lebensjahre bringen. Wer besonders aktiv ist, kann seine gesunde Lebenszeit sogar um bis zu 5 Jahre verlängern. Wer sich regelmäßig bewegt, lebt also nicht nur länger, sondern auch länger gesund, mobil und selbstständig.
Einteilung sportlicher Aktivität nach Intensität
Einteilung sportlicher Aktivität nach Intensität
Die Intensität kann auf verschiedene Weise eingeschätzt werden – entweder objektiv (z. B. über Herzfrequenz oder Sauerstoffaufnahme) oder subjektiv, also durch die eigene Wahrnehmung. Besonders gebräuchlich sind drei Methoden:
- Maximale Herzfrequenz (HFmax): Die höchste mögliche Herzfrequenz bei Belastung, grob berechnet mit der Formel 220 minus Lebensalter. Trainingsbereiche lassen sich in Prozent von der HFmax einteilen (siehe nächster Abschnitt).
- Borg-Skala: Selbsteinschätzungs-Skala der Anstrengung bei sportlicher Aktivität (siehe nächster Abschnitt).
- Sprechtest: Einfache Methode für den Alltag: Wenn man während der Aktivität noch gut sprechen kann, ist die Intensität moderat. Bei intensiver Belastung ist nur noch schweres oder gar kein Sprechen mehr möglich (siehe nächster Abschnitt).
Einteilung der Trainingsintensität bei Ausdauersport
Maximale Herzfrequenz
Subjektive Belastung nach der Borg-Skala
< 50% HFmax
6 - 11
Spazieren, langsames Radfahren, Dehnen
50 - 70% HFmax
12 - 13
Sprechen möglich
Nordic Walking, langsames Joggen
70 - 85 % HFmax
14 - 17
Sprechen nur noch schwer möglich
Joggen, schnelles Radfahren, Schwimmen
Intervalltraining, Sprinttraining
- Niedriger Intensität: < 40 % des 1-RM
- Moderate Intensität: 40–60 % des 1-RM
- Hohe Intensität: > 80 % des 1-RM
Therapieplan bei Bewegungsmangel - So erreichen Sie Schritt für Schritt die 150 Minuten pro Woche
Therapieplan bei Bewegungsmangel - So erreichen Sie Schritt für Schritt die 150 Minuten pro Woche
1. Ist-Zustand klären und Ziel formulieren
3. Steigerung der Sportzeiten bis auf 150 Minuten pro Woche
4. Erhaltung – Zielniveau erreichen und erhalten (150 Minuten/Woche plus Krafttraining)
Unterstützende Maßnahmen (optional)
Häufig gestellte Fragen zum Thema Rauchfreiheit (FAQ)
Häufig gestellte Fragen zum Thema Rauchfreiheit (FAQ)
Einschätzung mittels Borg-Skala: Eine subjektive Einschätzung der Anstrengung von 6 (sehr leicht) bis 20 (maximal). Werte von 12–13 gelten als moderat.
Einschätzung mittels Sprechtest: Kann man beim Training noch reden, ist es moderat; wenn Sprechen schwerfällt oder nicht mehr möglich ist, bewege ich mich im intensiven Bereich.
Unser Anliegen und Disclaimer
Unser Anliegen: Dieser Artikel erreicht vermutlich auch eher Menschen aus dem höheren Bildungs- und Einkommensniveau. Solltest du das hier lesen und dich selbst in der Gruppe "niedriger sozioökonomischer Status" ansehen, melde dich gerne bei uns. Wir interessieren uns sehr dafür, ob dich der Artikel angesprochen hat, ob er verständlich genug war und ob er dich von der Wichtigkeit der gesundheitlicher Maßnahmen überzeugen konnte.
Disclaimer: Dies ist keine medizinische Beratung und ersetzt nicht den Arztbesuch. Dies ist lediglich unsere Idee von Gesundheit und es wird keine Haftung für die Umsetzung dieser Idee übernommen.
Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie
15.03.2025
20.06.2025
05.07.2025
20.10.2025
Referenzen
- LeitlinienNationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung des Bundesministerium für Gesundheit: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Praevention/Broschueren/Bewegungsempfehlungen_BZgA-Fachheft_3.pdf
- KonsenzempfehlungStatement der American Heart Association (AHA): https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001189